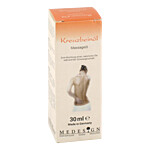Wirkungsweise
Wie wirkt der Inhaltsstoff des Arzneimittels?
Der Wirkstoff Zoledronsäure gehört zur Gruppe der Bisphosphonate. Zoledronsäure greift in den Knochenstoffwechsel ein und hemmt die Aktivität von Zellen, die im Körper am Abbau von Knochengewebe beteiligt sind (sog. Osteoklasten), was zu einem geringeren Verlust an Knochensubstanz führt. Durch die Hemmung des Knochenabbaus wird außerdem die aus den Knochen freigesetzte Calciummenge im Blut verringert.
Wie wirkt der Inhaltsstoff des Arzneimittels?
Der Wirkstoff Zoledronsäure gehört zur Gruppe der Bisphosphonate. Zoledronsäure greift in den Knochenstoffwechsel ein und hemmt die Aktivität von Zellen, die im Körper am Abbau von Knochengewebe beteiligt sind (sog. Osteoklasten), was zu einem geringeren Verlust an Knochensubstanz führt. Durch die Hemmung des Knochenabbaus wird außerdem die aus den Knochen freigesetzte Calciummenge im Blut verringert.
Wichtige Hinweise
Was sollten Sie beachten?
- Es kann Arzneimittel geben, mit denen Wechselwirkungen auftreten. Sie sollten deswegen generell vor der Behandlung mit einem neuen Arzneimittel jedes andere, das Sie bereits anwenden, dem Arzt oder Apotheker angeben. Das gilt auch für Arzneimittel, die Sie selbst kaufen, nur gelegentlich anwenden oder deren Anwendung schon einige Zeit zurückliegt.
Was sollten Sie beachten?
- Es kann Arzneimittel geben, mit denen Wechselwirkungen auftreten. Sie sollten deswegen generell vor der Behandlung mit einem neuen Arzneimittel jedes andere, das Sie bereits anwenden, dem Arzt oder Apotheker angeben. Das gilt auch für Arzneimittel, die Sie selbst kaufen, nur gelegentlich anwenden oder deren Anwendung schon einige Zeit zurückliegt.
Gegenanzeigen
Was spricht gegen eine Anwendung?
- Überempfindlichkeit gegen die Inhaltsstoffe
- Verminderter Kalziumgehalt im Blut (Hypokalzämie)
- Schwere Nierenfunktionsstörung
Welche Altersgruppe ist zu beachten?
- Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren: Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden.
Was ist mit Schwangerschaft und Stillzeit?
- Schwangerschaft: Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden.
- Stillzeit: Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden.
Ist Ihnen das Arzneimittel trotz einer Gegenanzeige verordnet worden, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker. Der therapeutische Nutzen kann höher sein, als das Risiko, das die Anwendung bei einer Gegenanzeige in sich birgt.
Was spricht gegen eine Anwendung?
- Überempfindlichkeit gegen die Inhaltsstoffe
- Verminderter Kalziumgehalt im Blut (Hypokalzämie)
- Schwere Nierenfunktionsstörung
Welche Altersgruppe ist zu beachten?
- Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren: Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden.
Was ist mit Schwangerschaft und Stillzeit?
- Schwangerschaft: Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden.
- Stillzeit: Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden.
Ist Ihnen das Arzneimittel trotz einer Gegenanzeige verordnet worden, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker. Der therapeutische Nutzen kann höher sein, als das Risiko, das die Anwendung bei einer Gegenanzeige in sich birgt.
Nebenwirkungen
Welche unerwünschten Wirkungen können auftreten?
- Fieber
- Verminderter Kalziumgehalt im Blut (Hypokalzämie)
- Kopfschmerzen
- Schwindelgefühl
- Rötung der Bindehaut des Auges
- Rhythmusstörung des Herzens mit beschleunigtem Herzschlag im Vorhof (Vorhofflimmern)
- Übelkeit
- Erbrechen
- Durchfall
- Muskelschmerzen
- Gelenkschmerzen
- Knochenschmerzen
- Rückenschmerzen
- Schmerzen im Arm oder im Bein
- Grippeartige Erkrankung
- Schüttelfrost
- Müdigkeit
- Kraftlosigkeit bzw. Schwäche
- Schmerzen
- Unwohlsein
- Reaktion an der Einstichstelle der Infusion
- Erhöhter Blutspiegel eines Entzündungsproteins (C-reaktivem Protein)
- Grippe
- Nasen-Rachen-Entzündung
- Blutarmut (Anämie)
- Appetitlosigkeit
- Schlaflosigkeit
- Schläfrigkeit mit erhöhter Reizschwelle
- Missempfindungen
- Schläfrigkeit
- Zittern
- Ohnmachtsanfall
- Störung des Geschmacksempfindens
- Bindehautentzündung
- Augenschmerzen
- Drehschwindel
- Herzklopfen
- Bluthochdruck
- Flüchtige, spontane Hautrötung der Wangen mit Hitzegefühl (Flush)
- Husten
- Kurzatmigkeit
- Verdauungsbeschwerden
- Schmerzen im Oberbauch
- Bauchschmerzen
- Rückfluss von Mageninhalt in die Speiseröhre mit Sodbrennen und Aufstoßen
- Verstopfung
- Mundtrockenheit
- Entzündung der Speiseröhre
- Zahnschmerz
- Magenschleimhautentzündung
- Hautausschlag
- Schwitzen (Hyperhidrose)
- Juckreiz (Pruritus)
- Hautrötung durch gesteigerte Durchblutung (Erythem)
- Nackenschmerzen
- Steifheit
- Gelenkschwellung
- Muskelkrampf
- Skelettmuskulatur betreffende Brustschmerzen
- Schmerzen im Haltungs- und Bewegungsapparat
- Gelenksteifigkeit
- Gelenkentzündung
- Muskelschwäche
- Erhöhte Nierenwerte (Kreatinin) im Blut
- Verstärkter Harndrang
- Erhöhte Eiweißausscheidung im Urin (Proteinurie)
- Wassereinlagerung an Armen und Beinen (periphere Ödeme)
- Durstgefühl
- Unspezifische Immunreaktion des Körpers (Akute-Phase-Reaktion)
- Brustkorbschmerzen
- Erniedrigter Kalziumgehalt im Blut
Bemerken Sie eine Befindlichkeitsstörung oder Veränderung während der Behandlung, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
Für die Information an dieser Stelle werden vor allem Nebenwirkungen berücksichtigt, die bei mindestens einem von 1.000 behandelten Patienten auftreten.
Welche unerwünschten Wirkungen können auftreten?
- Fieber
- Verminderter Kalziumgehalt im Blut (Hypokalzämie)
- Kopfschmerzen
- Schwindelgefühl
- Rötung der Bindehaut des Auges
- Rhythmusstörung des Herzens mit beschleunigtem Herzschlag im Vorhof (Vorhofflimmern)
- Übelkeit
- Erbrechen
- Durchfall
- Muskelschmerzen
- Gelenkschmerzen
- Knochenschmerzen
- Rückenschmerzen
- Schmerzen im Arm oder im Bein
- Grippeartige Erkrankung
- Schüttelfrost
- Müdigkeit
- Kraftlosigkeit bzw. Schwäche
- Schmerzen
- Unwohlsein
- Reaktion an der Einstichstelle der Infusion
- Erhöhter Blutspiegel eines Entzündungsproteins (C-reaktivem Protein)
- Grippe
- Nasen-Rachen-Entzündung
- Blutarmut (Anämie)
- Appetitlosigkeit
- Schlaflosigkeit
- Schläfrigkeit mit erhöhter Reizschwelle
- Missempfindungen
- Schläfrigkeit
- Zittern
- Ohnmachtsanfall
- Störung des Geschmacksempfindens
- Bindehautentzündung
- Augenschmerzen
- Drehschwindel
- Herzklopfen
- Bluthochdruck
- Flüchtige, spontane Hautrötung der Wangen mit Hitzegefühl (Flush)
- Husten
- Kurzatmigkeit
- Verdauungsbeschwerden
- Schmerzen im Oberbauch
- Bauchschmerzen
- Rückfluss von Mageninhalt in die Speiseröhre mit Sodbrennen und Aufstoßen
- Verstopfung
- Mundtrockenheit
- Entzündung der Speiseröhre
- Zahnschmerz
- Magenschleimhautentzündung
- Hautausschlag
- Schwitzen (Hyperhidrose)
- Juckreiz (Pruritus)
- Hautrötung durch gesteigerte Durchblutung (Erythem)
- Nackenschmerzen
- Steifheit
- Gelenkschwellung
- Muskelkrampf
- Skelettmuskulatur betreffende Brustschmerzen
- Schmerzen im Haltungs- und Bewegungsapparat
- Gelenksteifigkeit
- Gelenkentzündung
- Muskelschwäche
- Erhöhte Nierenwerte (Kreatinin) im Blut
- Verstärkter Harndrang
- Erhöhte Eiweißausscheidung im Urin (Proteinurie)
- Wassereinlagerung an Armen und Beinen (periphere Ödeme)
- Durstgefühl
- Unspezifische Immunreaktion des Körpers (Akute-Phase-Reaktion)
- Brustkorbschmerzen
- Erniedrigter Kalziumgehalt im Blut
Bemerken Sie eine Befindlichkeitsstörung oder Veränderung während der Behandlung, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
Für die Information an dieser Stelle werden vor allem Nebenwirkungen berücksichtigt, die bei mindestens einem von 1.000 behandelten Patienten auftreten.
Anwendungsgebiete
- Morbus Paget
- Corticoidinduzierte Osteoporose (Knochenschwund) beim Mann bei erhöhtem Risiko für Knochenbrüche
- Osteoporose bei Einnahme von Medikamenten (Kortisone) nach den Wechseljahren bei erhöhtem Risiko für Knochenbrüche
- Osteoporose (Knochenschwund) beim Mann bei erhöhtem Risiko für Knochenbrüche, einschließlich kürzlich erlittenem Hüftknochenbruch
- Osteoporose (Knochenschwund) bei der Frau nach den Wechseljahren bei erhöhtem Risiko für Knochenbrüche, einschließlich kürzlich erlittenem Hüftknochenbruch
- Morbus Paget
- Corticoidinduzierte Osteoporose (Knochenschwund) beim Mann bei erhöhtem Risiko für Knochenbrüche
- Osteoporose bei Einnahme von Medikamenten (Kortisone) nach den Wechseljahren bei erhöhtem Risiko für Knochenbrüche
- Osteoporose (Knochenschwund) beim Mann bei erhöhtem Risiko für Knochenbrüche, einschließlich kürzlich erlittenem Hüftknochenbruch
- Osteoporose (Knochenschwund) bei der Frau nach den Wechseljahren bei erhöhtem Risiko für Knochenbrüche, einschließlich kürzlich erlittenem Hüftknochenbruch
Was ist das? - Definition
Bei der Knochenerkrankung Morbus Paget läuft der Knochenstoffwechsel auf Hochtouren. Dadurch kommt es an einer oder mehreren Stellen zu einem übermäßigen Knochenumbau, der zu verdickten, aber brüchigen Knochen führt. An der langsam fortschreitenden Krankheit leiden vor allem ältere Menschen.
Wie wird es noch genannt? - Andere Bezeichnungen
- Ost(e)itis deformans
- Osteodystrophia deformans
- Paget-Erkrankung
Wie kommt es dazu? - Mögliche Ursachen
Die genaue Krankheitsursache ist nicht bekannt; neuere Studien weisen auf genetische Ursachen oder eine Virus-Infektion hin. Fest steht, dass der Knochenstoffwechsel der Betroffenen gestört ist. Bei gesunden Menschen befinden sich die Auf- und Abbauprozesse von Knochengewebe im Gleichgewicht. Anders bei Morbus-Paget-Patienten: Bei ihnen ist dieses Gleichgewicht gestört - sie bauen verstärkt Knochenmaterial ab. Als Reaktion darauf bildet der Körper unkontrolliert neues Knochengewebe, das allerdings weicher und somit anfälliger für Verformungen und Brüche ist als gesunde Knochen.
Wie macht es sich bemerkbar? - Symptome
Meist sind die Beschwerden uncharakteristisch. In vielen Fällen berichten Betroffene von lokalen Knochenschmerzen. Mitunter ist der hochtourige Knochenstoffwechsel durch die Haut als Überwärmung spürbar. Durch die veränderte Belastbarkeit des neuen Knochengewebes kann es zu Fehlbelastungen, Muskelverspannungen und -krämpfen kommen. Die Patienten erleiden oft Knochenbrüche, die Skelettdeformierungen nach sich ziehen können.
Wie geht es weiter? - Verlauf und Komplikationen
Im weiteren Verlauf der Erkrankung kommt es zu einer Verdickung des Schädels; der Kopfumfang nimmt zu. Sollten die Hirnnerven durch das Knochenwachstum beeinträchtigt werden, kann dies zu Schwerhörigkeit und Erblindung führen. Die Betroffenen haben ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines bösartigen Knochentumors und sollten sich daher regelmäßig ärztlichen Kontrollen unterziehen.
Was kann noch dahinter stecken? - Krankheitsbilder mit ähnlichen Symptomen
Andere Knochenerkrankungen wie beispielsweise Osteomalazie oder Knochenmetastasen führen zu ähnlichen Beschwerden.
Bearbeitungsstand: 23.11.2021
Quellenangaben:
Thews, Mutschler, Vaupel, Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des Menschen, WVG, (2007), 5. Aufl. - Mutschler, Arzneimittelwirkungen, Wiss.Verl.-Ges., (2008), Aufl. 9 - Brunkhorst, Schölmerich, Differenzialdiagnostik und Differenzialtherapie, Elsevier (Urban & Fischer), (2010), 1. Auflage
Die Information liefert nur eine kurze Beschreibung des Krankheitsbildes, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie sollte keinesfalls eine Grundlage sein, um selbst ein Krankheitsbild zu erkennen oder zu behandeln. Sollten bei Ihnen die beschriebenen Beschwerden auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
Was ist das? - Definition
Die Osteoporose ist eine Knochenerkrankung, bei der es zu einer Abnahme der Knochensubstanz gekommen ist. Das Risiko eines Knochenbruches ist dadurch erhöht.
Wie wird es noch genannt? - Andere Bezeichnungen
- Knochenschwund
Wie kommt es dazu? - Mögliche Ursache
Die Osteoporose ist die häufigste Knochenkrankheit der westlichen Welt. Betroffen sind vor allem Frauen über 60 Jahre.
Auch wenn es nicht den Anschein hat, ist ein Knochen ein "lebendes" Gewebe, in dem ständig Auf- und Abbauprozesse ablaufen. Normalerweise stehen diese Prozesse im Gleichgewicht, das heißt, abgebauter Knochen wird sofort wieder aufgebaut. Somit bleibt die Knochensubstanz konstant.
Bei der Osteoporose ist dieser Prozess aus dem Gleichgewicht geraten und es kommt zum vermehrten Knochenabbau bei vermindertem Knochenaufbau. Der Knochen wird porös und es besteht eine erhöhte Gefahr von Knochenbrüchen.
Frauen in den Wechseljahren haben ein erhöhtes Osteoporoserisiko: Bei Mangel an dem weiblichen Geschlechtshormon Östrogen kommt es zu einer verminderten Calciumaufnahme aus dem Darm und zu einer vermehrten Freisetzung dieses Minerals aus dem Knochen. Das bedeutet, dass langfristig die Knochenmasse abnimmt und sich eine Osteoporose entwickelt. Bei der häufigsten Form der Osteoporose ist besonders die Wirbelsäule betroffen, während es nur selten zu Veränderungen im Bereich der Arme und Beine kommt.
Osteoporose ist aber keine reine Frauenkrankheit, da es auch altersbedingt zu einem natürlichen Knochenschwund kommt. Diese Form tritt erst ab dem 70. Lebensjahr auf und betrifft auch Männer. Typischerweise kommt es besonders im Bereich des Oberschenkelknochens zu Veränderungen. Deshalb ist der Oberschenkelhalsbruch eine häufige Komplikation im Alter.
Doch auch im Rahmen einer lang dauernden hochdosierten Cortisontherapie, bei bestimmten Stoffwechselerkrankungen (z.B. einer Schilddrüsenüberfunktion), infolge langer Bettlägerigkeit oder einer Querschnittslähmung kann sich eine Osteoporose entwickeln.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei folgenden Konstellationen das Osteoporoserisiko erhöht ist:
- Geschlecht: Osteoporose ist besonders eine Erkrankung der älteren Frau, doch auch Männer sind betroffen.
- Vererbung: bei Fällen von Osteoporose in der Familie besteht ein erhöhtes Risiko.
- Ethnische Zugehörigkeit: Osteoporose ist bei weißen Frauen häufiger.
- Körperbau: bei schlanken und grazilen Menschen kommt es häufiger zur Osteoporose, als bei Menschen mit stämmigem Körperbau.
- Lebensführung: Bewegungsmangel (z.B. rein sitzende Tätigkeit), Rauchen und chronischer Alkoholgenuss sind Risikofaktoren für eine Osteoporose.
Wie macht es sich bemerkbar? - Symptome
Osteoporose ist eine schleichend verlaufende Krankheit, die lange Zeit keinerlei Beschwerden verursacht.
Erst nach Jahren können akute und vor allem chronische Rückenschmerzen auftreten, denn betroffen ist hauptsächlich die Wirbelsäule. Durch den Knochenschwund wird der Knochen instabil und kann leicht in sich zusammenbrechen. Folge ist eine Verformung der Wirbelsäule, die zu Fehlhaltung, Muskelverspannungen und deshalb zu chronischen Schmerzen führt. Anfangs treten die Beschwerden nur bei besonderer Belastung auf, später gehen sie in Dauerschmerzen über.
Die Veränderungen im Bereich der Wirbelsäule führen zu typischen Änderungen der Körperstatur :
- Die Verformung der Wirbelsäule führt zu einer zunehmenden Krümmung der Brustwirbelsäule, zum "Buckel", früher "Witwenbuckel" genannt. Die Verformung der Wirbelsäule kann so ausgeprägt sein, dass die unteren Rippen am Beckenkamm scheuern.
- Durch die Krümmung der Wirbelsäule nimmt die Körpergröße stetig ab.
- Es kommt zu einer Verschiebung der Hautfalten: die Patientinnen berichten vom Verlust der Taille ("kein Rock passt mehr"), weil der Bauch extrem vorgewölbt ist.
Wie geht es weiter? - Verlauf und Komplikationen
Man nennt die Osteoporose auch "Frakturkrankheit", weil es oft schon bei kleinen Unfällen oder auch ohne Anlass zu Knochenbrüchen kommen kann.
Was kann noch dahinter stecken? - Krankheitsbilder mit ähnlichen Symptomen
Bei Menschen, die bettlägerig sind und deshalb nie an die Sonne kommen, kann es zur Osteomalazie, einer Knochenerweichung infolge Vitamin D-Mangels, kommen. Vitamin D ist wichtig für die Aufnahme von Calcium aus dem Darm. Wir nehmen es mit der Nahrung zu uns oder es wird in der Haut mit Hilfe von Sonnenlicht gebildet. Fehlt Calcium, kann es nicht ausreichend in den Knochen eingebaut werden. Deshalb werden die Knochen weich. Folge sind chronische Knochenschmerzen.
Die Osteochondrose ist eine Form der Arthrose, des Gelenkverschleißes. Hier sind die kleinen Gelenke zwischen den einzelnen Wirbeln betroffen. Folge sind auch hier chronische Rückenschmerzen wechselnder Stärke. Im Gegensatz zur Osteoporose kommt es hier aber nicht zur Verkrümmung der Wirbelsäule.
Verhaltenstipps
- Zur Vermeidung einer Osteoporose ist eine Calcium-reiche Ernährung wichtig. Zum Erhalt der Knochenstabilität benötigen Erwachsene täglich 1000 bis 1500 mg Calcium. 0,5 Liter Milch (2-3 Gläser) und 50 g Hartkäse (ca. 2 Scheiben) decken den täglichen Calciumbedarf.
- Zu empfehlen ist ein gezieltes Training der Bauch- und Rückenmuskulatur, da die Osteoporose besonders die Wirbelsäule betrifft.
- Schwimmen ist eine ideale Kombination aus Wirbelsäulenentlastung und Muskeltraining, da im Wasser die Wirbelsäule durch den Auftrieb entlastet wird.
- Ganz besonders wichtig aber ist die tägliche Bewegung an der frischen Luft, denn nur ein Knochen, der regelmäßig belastet wird, bleibt stabil. Zur Einlagerung von Calcium in den Knochen brauchen wir Vitamin D, welches in der Haut unter Einfluss von Sonnenlicht gebildet wird. Es kommt nicht auf die direkte Sonneneinstrahlung an, auch ein bedeckter Himmel oder ein Sonnenschirm mindern die Wirkung des Sonnenlichtes nicht.
Zur Entlastung der Wirbelsäule sind folgende Maßnahmen empfehlenswert:
- Fahrradfahren: Der Lenker sollte so hoch gestellt sein, dass man aufrecht sitzen muss, so trainiert man die Rückenmuskulatur.
- Schuhe mit weicher Sohle zur Entlastung der Wirbelsäule und der Gelenke.
- Bei Übergewicht abnehmen, denn Übergewicht belastet die Knochen und Gelenke.
- Langes Stehen und Sitzen vermeiden, möglichst viel laufen, das fördert den Knochenstoffwechsel.
- Das Heben von schweren Lasten vermeiden, besser ist ein Transport auf fahrbaren Geräten.
Bearbeitungsstand: 25.10.2021
Quellenangaben:
Thews, Mutschler, Vaupel, Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des Menschen, WVG, (2007), 5. Aufl. - Andreae, von Hayek, Weniger, Krankheitslehre für Altenpflege, Thieme, (2006) - Brunkhorst, Schölmerich, Differenzialdiagnostik und Differenzialtherapie, Elsevier (Urban & Fischer), (2010), 1. Auflage - Wülker, Orthopädie und Unfallchirurgie, Thieme, (2009), 2. Auflage
Die Information liefert nur eine kurze Beschreibung des Krankheitsbildes, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie sollte keinesfalls eine Grundlage sein, um selbst ein Krankheitsbild zu erkennen oder zu behandeln. Sollten bei Ihnen die beschriebenen Beschwerden auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
Was ist das? - Definition
Die Osteoporose ist eine Knochenerkrankung, bei der es zu einer Abnahme der Knochensubstanz gekommen ist. Das Risiko eines Knochenbruches ist dadurch erhöht.
Wie wird es noch genannt? - Andere Bezeichnungen
- Knochenschwund
Wie kommt es dazu? - Mögliche Ursache
Die Osteoporose ist die häufigste Knochenkrankheit der westlichen Welt. Betroffen sind vor allem Frauen über 60 Jahre.
Auch wenn es nicht den Anschein hat, ist ein Knochen ein "lebendes" Gewebe, in dem ständig Auf- und Abbauprozesse ablaufen. Normalerweise stehen diese Prozesse im Gleichgewicht, das heißt, abgebauter Knochen wird sofort wieder aufgebaut. Somit bleibt die Knochensubstanz konstant.
Bei der Osteoporose ist dieser Prozess aus dem Gleichgewicht geraten und es kommt zum vermehrten Knochenabbau bei vermindertem Knochenaufbau. Der Knochen wird porös und es besteht eine erhöhte Gefahr von Knochenbrüchen.
Frauen in den Wechseljahren haben ein erhöhtes Osteoporoserisiko: Bei Mangel an dem weiblichen Geschlechtshormon Östrogen kommt es zu einer verminderten Calciumaufnahme aus dem Darm und zu einer vermehrten Freisetzung dieses Minerals aus dem Knochen. Das bedeutet, dass langfristig die Knochenmasse abnimmt und sich eine Osteoporose entwickelt. Bei der häufigsten Form der Osteoporose ist besonders die Wirbelsäule betroffen, während es nur selten zu Veränderungen im Bereich der Arme und Beine kommt.
Osteoporose ist aber keine reine Frauenkrankheit, da es auch altersbedingt zu einem natürlichen Knochenschwund kommt. Diese Form tritt erst ab dem 70. Lebensjahr auf und betrifft auch Männer. Typischerweise kommt es besonders im Bereich des Oberschenkelknochens zu Veränderungen. Deshalb ist der Oberschenkelhalsbruch eine häufige Komplikation im Alter.
Doch auch im Rahmen einer lang dauernden hochdosierten Cortisontherapie, bei bestimmten Stoffwechselerkrankungen (z.B. einer Schilddrüsenüberfunktion), infolge langer Bettlägerigkeit oder einer Querschnittslähmung kann sich eine Osteoporose entwickeln.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei folgenden Konstellationen das Osteoporoserisiko erhöht ist:
- Geschlecht: Osteoporose ist besonders eine Erkrankung der älteren Frau, doch auch Männer sind betroffen.
- Vererbung: bei Fällen von Osteoporose in der Familie besteht ein erhöhtes Risiko.
- Ethnische Zugehörigkeit: Osteoporose ist bei weißen Frauen häufiger.
- Körperbau: bei schlanken und grazilen Menschen kommt es häufiger zur Osteoporose, als bei Menschen mit stämmigem Körperbau.
- Lebensführung: Bewegungsmangel (z.B. rein sitzende Tätigkeit), Rauchen und chronischer Alkoholgenuss sind Risikofaktoren für eine Osteoporose.
Wie macht es sich bemerkbar? - Symptome
Osteoporose ist eine schleichend verlaufende Krankheit, die lange Zeit keinerlei Beschwerden verursacht.
Erst nach Jahren können akute und vor allem chronische Rückenschmerzen auftreten, denn betroffen ist hauptsächlich die Wirbelsäule. Durch den Knochenschwund wird der Knochen instabil und kann leicht in sich zusammenbrechen. Folge ist eine Verformung der Wirbelsäule, die zu Fehlhaltung, Muskelverspannungen und deshalb zu chronischen Schmerzen führt. Anfangs treten die Beschwerden nur bei besonderer Belastung auf, später gehen sie in Dauerschmerzen über.
Die Veränderungen im Bereich der Wirbelsäule führen zu typischen Änderungen der Körperstatur :
- Die Verformung der Wirbelsäule führt zu einer zunehmenden Krümmung der Brustwirbelsäule, zum "Buckel", früher "Witwenbuckel" genannt. Die Verformung der Wirbelsäule kann so ausgeprägt sein, dass die unteren Rippen am Beckenkamm scheuern.
- Durch die Krümmung der Wirbelsäule nimmt die Körpergröße stetig ab.
- Es kommt zu einer Verschiebung der Hautfalten: die Patientinnen berichten vom Verlust der Taille ("kein Rock passt mehr"), weil der Bauch extrem vorgewölbt ist.
Wie geht es weiter? - Verlauf und Komplikationen
Man nennt die Osteoporose auch "Frakturkrankheit", weil es oft schon bei kleinen Unfällen oder auch ohne Anlass zu Knochenbrüchen kommen kann.
Was kann noch dahinter stecken? - Krankheitsbilder mit ähnlichen Symptomen
Bei Menschen, die bettlägerig sind und deshalb nie an die Sonne kommen, kann es zur Osteomalazie, einer Knochenerweichung infolge Vitamin D-Mangels, kommen. Vitamin D ist wichtig für die Aufnahme von Calcium aus dem Darm. Wir nehmen es mit der Nahrung zu uns oder es wird in der Haut mit Hilfe von Sonnenlicht gebildet. Fehlt Calcium, kann es nicht ausreichend in den Knochen eingebaut werden. Deshalb werden die Knochen weich. Folge sind chronische Knochenschmerzen.
Die Osteochondrose ist eine Form der Arthrose, des Gelenkverschleißes. Hier sind die kleinen Gelenke zwischen den einzelnen Wirbeln betroffen. Folge sind auch hier chronische Rückenschmerzen wechselnder Stärke. Im Gegensatz zur Osteoporose kommt es hier aber nicht zur Verkrümmung der Wirbelsäule.
Verhaltenstipps
- Zur Vermeidung einer Osteoporose ist eine Calcium-reiche Ernährung wichtig. Zum Erhalt der Knochenstabilität benötigen Erwachsene täglich 1000 bis 1500 mg Calcium. 0,5 Liter Milch (2-3 Gläser) und 50 g Hartkäse (ca. 2 Scheiben) decken den täglichen Calciumbedarf.
- Zu empfehlen ist ein gezieltes Training der Bauch- und Rückenmuskulatur, da die Osteoporose besonders die Wirbelsäule betrifft.
- Schwimmen ist eine ideale Kombination aus Wirbelsäulenentlastung und Muskeltraining, da im Wasser die Wirbelsäule durch den Auftrieb entlastet wird.
- Ganz besonders wichtig aber ist die tägliche Bewegung an der frischen Luft, denn nur ein Knochen, der regelmäßig belastet wird, bleibt stabil. Zur Einlagerung von Calcium in den Knochen brauchen wir Vitamin D, welches in der Haut unter Einfluss von Sonnenlicht gebildet wird. Es kommt nicht auf die direkte Sonneneinstrahlung an, auch ein bedeckter Himmel oder ein Sonnenschirm mindern die Wirkung des Sonnenlichtes nicht.
Zur Entlastung der Wirbelsäule sind folgende Maßnahmen empfehlenswert:
- Fahrradfahren: Der Lenker sollte so hoch gestellt sein, dass man aufrecht sitzen muss, so trainiert man die Rückenmuskulatur.
- Schuhe mit weicher Sohle zur Entlastung der Wirbelsäule und der Gelenke.
- Bei Übergewicht abnehmen, denn Übergewicht belastet die Knochen und Gelenke.
- Langes Stehen und Sitzen vermeiden, möglichst viel laufen, das fördert den Knochenstoffwechsel.
- Das Heben von schweren Lasten vermeiden, besser ist ein Transport auf fahrbaren Geräten.
Bearbeitungsstand: 25.10.2021
Quellenangaben:
Thews, Mutschler, Vaupel, Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des Menschen, WVG, (2007), 5. Aufl. - Andreae, von Hayek, Weniger, Krankheitslehre für Altenpflege, Thieme, (2006) - Brunkhorst, Schölmerich, Differenzialdiagnostik und Differenzialtherapie, Elsevier (Urban & Fischer), (2010), 1. Auflage - Wülker, Orthopädie und Unfallchirurgie, Thieme, (2009), 2. Auflage
Die Information liefert nur eine kurze Beschreibung des Krankheitsbildes, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie sollte keinesfalls eine Grundlage sein, um selbst ein Krankheitsbild zu erkennen oder zu behandeln. Sollten bei Ihnen die beschriebenen Beschwerden auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
Was ist das? - Definition
Die Osteoporose ist eine Knochenerkrankung, bei der es zu einer Abnahme der Knochensubstanz gekommen ist. Das Risiko eines Knochenbruches ist dadurch erhöht.
Wie wird es noch genannt? - Andere Bezeichnungen
- Knochenschwund
Wie kommt es dazu? - Mögliche Ursache
Die Osteoporose ist die häufigste Knochenkrankheit der westlichen Welt. Betroffen sind vor allem Frauen über 60 Jahre.
Auch wenn es nicht den Anschein hat, ist ein Knochen ein "lebendes" Gewebe, in dem ständig Auf- und Abbauprozesse ablaufen. Normalerweise stehen diese Prozesse im Gleichgewicht, das heißt, abgebauter Knochen wird sofort wieder aufgebaut. Somit bleibt die Knochensubstanz konstant.
Bei der Osteoporose ist dieser Prozess aus dem Gleichgewicht geraten und es kommt zum vermehrten Knochenabbau bei vermindertem Knochenaufbau. Der Knochen wird porös und es besteht eine erhöhte Gefahr von Knochenbrüchen.
Frauen in den Wechseljahren haben ein erhöhtes Osteoporoserisiko: Bei Mangel an dem weiblichen Geschlechtshormon Östrogen kommt es zu einer verminderten Calciumaufnahme aus dem Darm und zu einer vermehrten Freisetzung dieses Minerals aus dem Knochen. Das bedeutet, dass langfristig die Knochenmasse abnimmt und sich eine Osteoporose entwickelt. Bei der häufigsten Form der Osteoporose ist besonders die Wirbelsäule betroffen, während es nur selten zu Veränderungen im Bereich der Arme und Beine kommt.
Osteoporose ist aber keine reine Frauenkrankheit, da es auch altersbedingt zu einem natürlichen Knochenschwund kommt. Diese Form tritt erst ab dem 70. Lebensjahr auf und betrifft auch Männer. Typischerweise kommt es besonders im Bereich des Oberschenkelknochens zu Veränderungen. Deshalb ist der Oberschenkelhalsbruch eine häufige Komplikation im Alter.
Doch auch im Rahmen einer lang dauernden hochdosierten Cortisontherapie, bei bestimmten Stoffwechselerkrankungen (z.B. einer Schilddrüsenüberfunktion), infolge langer Bettlägerigkeit oder einer Querschnittslähmung kann sich eine Osteoporose entwickeln.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei folgenden Konstellationen das Osteoporoserisiko erhöht ist:
- Geschlecht: Osteoporose ist besonders eine Erkrankung der älteren Frau, doch auch Männer sind betroffen.
- Vererbung: bei Fällen von Osteoporose in der Familie besteht ein erhöhtes Risiko.
- Ethnische Zugehörigkeit: Osteoporose ist bei weißen Frauen häufiger.
- Körperbau: bei schlanken und grazilen Menschen kommt es häufiger zur Osteoporose, als bei Menschen mit stämmigem Körperbau.
- Lebensführung: Bewegungsmangel (z.B. rein sitzende Tätigkeit), Rauchen und chronischer Alkoholgenuss sind Risikofaktoren für eine Osteoporose.
Wie macht es sich bemerkbar? - Symptome
Osteoporose ist eine schleichend verlaufende Krankheit, die lange Zeit keinerlei Beschwerden verursacht.
Erst nach Jahren können akute und vor allem chronische Rückenschmerzen auftreten, denn betroffen ist hauptsächlich die Wirbelsäule. Durch den Knochenschwund wird der Knochen instabil und kann leicht in sich zusammenbrechen. Folge ist eine Verformung der Wirbelsäule, die zu Fehlhaltung, Muskelverspannungen und deshalb zu chronischen Schmerzen führt. Anfangs treten die Beschwerden nur bei besonderer Belastung auf, später gehen sie in Dauerschmerzen über.
Die Veränderungen im Bereich der Wirbelsäule führen zu typischen Änderungen der Körperstatur :
- Die Verformung der Wirbelsäule führt zu einer zunehmenden Krümmung der Brustwirbelsäule, zum "Buckel", früher "Witwenbuckel" genannt. Die Verformung der Wirbelsäule kann so ausgeprägt sein, dass die unteren Rippen am Beckenkamm scheuern.
- Durch die Krümmung der Wirbelsäule nimmt die Körpergröße stetig ab.
- Es kommt zu einer Verschiebung der Hautfalten: die Patientinnen berichten vom Verlust der Taille ("kein Rock passt mehr"), weil der Bauch extrem vorgewölbt ist.
Wie geht es weiter? - Verlauf und Komplikationen
Man nennt die Osteoporose auch "Frakturkrankheit", weil es oft schon bei kleinen Unfällen oder auch ohne Anlass zu Knochenbrüchen kommen kann.
Was kann noch dahinter stecken? - Krankheitsbilder mit ähnlichen Symptomen
Bei Menschen, die bettlägerig sind und deshalb nie an die Sonne kommen, kann es zur Osteomalazie, einer Knochenerweichung infolge Vitamin D-Mangels, kommen. Vitamin D ist wichtig für die Aufnahme von Calcium aus dem Darm. Wir nehmen es mit der Nahrung zu uns oder es wird in der Haut mit Hilfe von Sonnenlicht gebildet. Fehlt Calcium, kann es nicht ausreichend in den Knochen eingebaut werden. Deshalb werden die Knochen weich. Folge sind chronische Knochenschmerzen.
Die Osteochondrose ist eine Form der Arthrose, des Gelenkverschleißes. Hier sind die kleinen Gelenke zwischen den einzelnen Wirbeln betroffen. Folge sind auch hier chronische Rückenschmerzen wechselnder Stärke. Im Gegensatz zur Osteoporose kommt es hier aber nicht zur Verkrümmung der Wirbelsäule.
Verhaltenstipps
- Zur Vermeidung einer Osteoporose ist eine Calcium-reiche Ernährung wichtig. Zum Erhalt der Knochenstabilität benötigen Erwachsene täglich 1000 bis 1500 mg Calcium. 0,5 Liter Milch (2-3 Gläser) und 50 g Hartkäse (ca. 2 Scheiben) decken den täglichen Calciumbedarf.
- Zu empfehlen ist ein gezieltes Training der Bauch- und Rückenmuskulatur, da die Osteoporose besonders die Wirbelsäule betrifft.
- Schwimmen ist eine ideale Kombination aus Wirbelsäulenentlastung und Muskeltraining, da im Wasser die Wirbelsäule durch den Auftrieb entlastet wird.
- Ganz besonders wichtig aber ist die tägliche Bewegung an der frischen Luft, denn nur ein Knochen, der regelmäßig belastet wird, bleibt stabil. Zur Einlagerung von Calcium in den Knochen brauchen wir Vitamin D, welches in der Haut unter Einfluss von Sonnenlicht gebildet wird. Es kommt nicht auf die direkte Sonneneinstrahlung an, auch ein bedeckter Himmel oder ein Sonnenschirm mindern die Wirkung des Sonnenlichtes nicht.
Zur Entlastung der Wirbelsäule sind folgende Maßnahmen empfehlenswert:
- Fahrradfahren: Der Lenker sollte so hoch gestellt sein, dass man aufrecht sitzen muss, so trainiert man die Rückenmuskulatur.
- Schuhe mit weicher Sohle zur Entlastung der Wirbelsäule und der Gelenke.
- Bei Übergewicht abnehmen, denn Übergewicht belastet die Knochen und Gelenke.
- Langes Stehen und Sitzen vermeiden, möglichst viel laufen, das fördert den Knochenstoffwechsel.
- Das Heben von schweren Lasten vermeiden, besser ist ein Transport auf fahrbaren Geräten.
Bearbeitungsstand: 25.10.2021
Quellenangaben:
Thews, Mutschler, Vaupel, Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des Menschen, WVG, (2007), 5. Aufl. - Andreae, von Hayek, Weniger, Krankheitslehre für Altenpflege, Thieme, (2006) - Brunkhorst, Schölmerich, Differenzialdiagnostik und Differenzialtherapie, Elsevier (Urban & Fischer), (2010), 1. Auflage - Wülker, Orthopädie und Unfallchirurgie, Thieme, (2009), 2. Auflage
Die Information liefert nur eine kurze Beschreibung des Krankheitsbildes, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie sollte keinesfalls eine Grundlage sein, um selbst ein Krankheitsbild zu erkennen oder zu behandeln. Sollten bei Ihnen die beschriebenen Beschwerden auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
Was ist das? - Definition
Die Osteoporose ist eine Knochenerkrankung, bei der es zu einer Abnahme der Knochensubstanz gekommen ist. Das Risiko eines Knochenbruches ist dadurch erhöht.
Wie wird es noch genannt? - Andere Bezeichnungen
- Knochenschwund
Wie kommt es dazu? - Mögliche Ursache
Die Osteoporose ist die häufigste Knochenkrankheit der westlichen Welt. Betroffen sind vor allem Frauen über 60 Jahre.
Auch wenn es nicht den Anschein hat, ist ein Knochen ein "lebendes" Gewebe, in dem ständig Auf- und Abbauprozesse ablaufen. Normalerweise stehen diese Prozesse im Gleichgewicht, das heißt, abgebauter Knochen wird sofort wieder aufgebaut. Somit bleibt die Knochensubstanz konstant.
Bei der Osteoporose ist dieser Prozess aus dem Gleichgewicht geraten und es kommt zum vermehrten Knochenabbau bei vermindertem Knochenaufbau. Der Knochen wird porös und es besteht eine erhöhte Gefahr von Knochenbrüchen.
Frauen in den Wechseljahren haben ein erhöhtes Osteoporoserisiko: Bei Mangel an dem weiblichen Geschlechtshormon Östrogen kommt es zu einer verminderten Calciumaufnahme aus dem Darm und zu einer vermehrten Freisetzung dieses Minerals aus dem Knochen. Das bedeutet, dass langfristig die Knochenmasse abnimmt und sich eine Osteoporose entwickelt. Bei der häufigsten Form der Osteoporose ist besonders die Wirbelsäule betroffen, während es nur selten zu Veränderungen im Bereich der Arme und Beine kommt.
Osteoporose ist aber keine reine Frauenkrankheit, da es auch altersbedingt zu einem natürlichen Knochenschwund kommt. Diese Form tritt erst ab dem 70. Lebensjahr auf und betrifft auch Männer. Typischerweise kommt es besonders im Bereich des Oberschenkelknochens zu Veränderungen. Deshalb ist der Oberschenkelhalsbruch eine häufige Komplikation im Alter.
Doch auch im Rahmen einer lang dauernden hochdosierten Cortisontherapie, bei bestimmten Stoffwechselerkrankungen (z.B. einer Schilddrüsenüberfunktion), infolge langer Bettlägerigkeit oder einer Querschnittslähmung kann sich eine Osteoporose entwickeln.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei folgenden Konstellationen das Osteoporoserisiko erhöht ist:
- Geschlecht: Osteoporose ist besonders eine Erkrankung der älteren Frau, doch auch Männer sind betroffen.
- Vererbung: bei Fällen von Osteoporose in der Familie besteht ein erhöhtes Risiko.
- Ethnische Zugehörigkeit: Osteoporose ist bei weißen Frauen häufiger.
- Körperbau: bei schlanken und grazilen Menschen kommt es häufiger zur Osteoporose, als bei Menschen mit stämmigem Körperbau.
- Lebensführung: Bewegungsmangel (z.B. rein sitzende Tätigkeit), Rauchen und chronischer Alkoholgenuss sind Risikofaktoren für eine Osteoporose.
Wie macht es sich bemerkbar? - Symptome
Osteoporose ist eine schleichend verlaufende Krankheit, die lange Zeit keinerlei Beschwerden verursacht.
Erst nach Jahren können akute und vor allem chronische Rückenschmerzen auftreten, denn betroffen ist hauptsächlich die Wirbelsäule. Durch den Knochenschwund wird der Knochen instabil und kann leicht in sich zusammenbrechen. Folge ist eine Verformung der Wirbelsäule, die zu Fehlhaltung, Muskelverspannungen und deshalb zu chronischen Schmerzen führt. Anfangs treten die Beschwerden nur bei besonderer Belastung auf, später gehen sie in Dauerschmerzen über.
Die Veränderungen im Bereich der Wirbelsäule führen zu typischen Änderungen der Körperstatur :
- Die Verformung der Wirbelsäule führt zu einer zunehmenden Krümmung der Brustwirbelsäule, zum "Buckel", früher "Witwenbuckel" genannt. Die Verformung der Wirbelsäule kann so ausgeprägt sein, dass die unteren Rippen am Beckenkamm scheuern.
- Durch die Krümmung der Wirbelsäule nimmt die Körpergröße stetig ab.
- Es kommt zu einer Verschiebung der Hautfalten: die Patientinnen berichten vom Verlust der Taille ("kein Rock passt mehr"), weil der Bauch extrem vorgewölbt ist.
Wie geht es weiter? - Verlauf und Komplikationen
Man nennt die Osteoporose auch "Frakturkrankheit", weil es oft schon bei kleinen Unfällen oder auch ohne Anlass zu Knochenbrüchen kommen kann.
Was kann noch dahinter stecken? - Krankheitsbilder mit ähnlichen Symptomen
Bei Menschen, die bettlägerig sind und deshalb nie an die Sonne kommen, kann es zur Osteomalazie, einer Knochenerweichung infolge Vitamin D-Mangels, kommen. Vitamin D ist wichtig für die Aufnahme von Calcium aus dem Darm. Wir nehmen es mit der Nahrung zu uns oder es wird in der Haut mit Hilfe von Sonnenlicht gebildet. Fehlt Calcium, kann es nicht ausreichend in den Knochen eingebaut werden. Deshalb werden die Knochen weich. Folge sind chronische Knochenschmerzen.
Die Osteochondrose ist eine Form der Arthrose, des Gelenkverschleißes. Hier sind die kleinen Gelenke zwischen den einzelnen Wirbeln betroffen. Folge sind auch hier chronische Rückenschmerzen wechselnder Stärke. Im Gegensatz zur Osteoporose kommt es hier aber nicht zur Verkrümmung der Wirbelsäule.
Verhaltenstipps
- Zur Vermeidung einer Osteoporose ist eine Calcium-reiche Ernährung wichtig. Zum Erhalt der Knochenstabilität benötigen Erwachsene täglich 1000 bis 1500 mg Calcium. 0,5 Liter Milch (2-3 Gläser) und 50 g Hartkäse (ca. 2 Scheiben) decken den täglichen Calciumbedarf.
- Zu empfehlen ist ein gezieltes Training der Bauch- und Rückenmuskulatur, da die Osteoporose besonders die Wirbelsäule betrifft.
- Schwimmen ist eine ideale Kombination aus Wirbelsäulenentlastung und Muskeltraining, da im Wasser die Wirbelsäule durch den Auftrieb entlastet wird.
- Ganz besonders wichtig aber ist die tägliche Bewegung an der frischen Luft, denn nur ein Knochen, der regelmäßig belastet wird, bleibt stabil. Zur Einlagerung von Calcium in den Knochen brauchen wir Vitamin D, welches in der Haut unter Einfluss von Sonnenlicht gebildet wird. Es kommt nicht auf die direkte Sonneneinstrahlung an, auch ein bedeckter Himmel oder ein Sonnenschirm mindern die Wirkung des Sonnenlichtes nicht.
Zur Entlastung der Wirbelsäule sind folgende Maßnahmen empfehlenswert:
- Fahrradfahren: Der Lenker sollte so hoch gestellt sein, dass man aufrecht sitzen muss, so trainiert man die Rückenmuskulatur.
- Schuhe mit weicher Sohle zur Entlastung der Wirbelsäule und der Gelenke.
- Bei Übergewicht abnehmen, denn Übergewicht belastet die Knochen und Gelenke.
- Langes Stehen und Sitzen vermeiden, möglichst viel laufen, das fördert den Knochenstoffwechsel.
- Das Heben von schweren Lasten vermeiden, besser ist ein Transport auf fahrbaren Geräten.
Bearbeitungsstand: 25.10.2021
Quellenangaben:
Thews, Mutschler, Vaupel, Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des Menschen, WVG, (2007), 5. Aufl. - Andreae, von Hayek, Weniger, Krankheitslehre für Altenpflege, Thieme, (2006) - Brunkhorst, Schölmerich, Differenzialdiagnostik und Differenzialtherapie, Elsevier (Urban & Fischer), (2010), 1. Auflage - Wülker, Orthopädie und Unfallchirurgie, Thieme, (2009), 2. Auflage
Die Information liefert nur eine kurze Beschreibung des Krankheitsbildes, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie sollte keinesfalls eine Grundlage sein, um selbst ein Krankheitsbild zu erkennen oder zu behandeln. Sollten bei Ihnen die beschriebenen Beschwerden auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
Dosierung und Anwendungshinweise
Wie wird das Arzneimittel dosiert?
Wie wird das Arzneimittel dosiert?
| Wer | Einzeldosis | Gesamtdosis | Wann |
|---|
Anwendungshinweise
Art der Anwendung?
Die Anwendung sollte nur durch Fachpersonal erfolgen.
Dauer der Anwendung?
Die Anwendungsdauer richtet sich nach Art der Beschwerde und/oder Dauer der Erkrankung und wird deshalb nur von Ihrem Arzt bestimmt.
Überdosierung?
Bei einer Überdosierung kann es einem verminderten Kalziumgehalt im Blut kommen. Setzen Sie sich bei dem Verdacht auf eine Überdosierung umgehend mit einem Arzt in Verbindung.
Generell gilt: Achten Sie vor allem bei Säuglingen, Kleinkindern und älteren Menschen auf eine gewissenhafte Dosierung. Im Zweifelsfalle fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker nach etwaigen Auswirkungen oder Vorsichtsmaßnahmen.
Eine vom Arzt verordnete Dosierung kann von den Angaben der Packungsbeilage abweichen. Da der Arzt sie individuell abstimmt, sollten Sie das Arzneimittel daher nach seinen Anweisungen anwenden.
Art der Anwendung?
Die Anwendung sollte nur durch Fachpersonal erfolgen.
Dauer der Anwendung?
Die Anwendungsdauer richtet sich nach Art der Beschwerde und/oder Dauer der Erkrankung und wird deshalb nur von Ihrem Arzt bestimmt.
Überdosierung?
Bei einer Überdosierung kann es einem verminderten Kalziumgehalt im Blut kommen. Setzen Sie sich bei dem Verdacht auf eine Überdosierung umgehend mit einem Arzt in Verbindung.
Generell gilt: Achten Sie vor allem bei Säuglingen, Kleinkindern und älteren Menschen auf eine gewissenhafte Dosierung. Im Zweifelsfalle fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker nach etwaigen Auswirkungen oder Vorsichtsmaßnahmen.
Eine vom Arzt verordnete Dosierung kann von den Angaben der Packungsbeilage abweichen. Da der Arzt sie individuell abstimmt, sollten Sie das Arzneimittel daher nach seinen Anweisungen anwenden.
Zusammensetzung
Was ist im Arzneimittel enthalten?
Die angegebenen Mengen sind bezogen auf 0,1 Liter Lösung = 1 Flasche.
Was ist im Arzneimittel enthalten?
Die angegebenen Mengen sind bezogen auf 0,1 Liter Lösung = 1 Flasche.
| Hilfstoff | + | Wasser für Injektionszwecke |
| Hilfstoff | + | Natrium citrat |
| Hilfstoff | + | Mannitol |
| entspricht | 5 mg | Zoledronsäure |
| Wirkstoffstoff | 5,33 mg | Zoledronsäure-1-Wasser |
Kundenrezensionen
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt oder fragen Sie in Ihrer Apotheke.
GPSR-Informationen:
Docpharm GmbH
Strasse: Borsigstr.3
PLZ / Ort: 71263 Weil der Stadt
Land: Deutschland
Webseite: www.docpharm.de
Telefonnummer: +49 721 790709-0
Email: info@docpharm.de
Docpharm GmbH
Strasse: Borsigstr.3
PLZ / Ort: 71263 Weil der Stadt
Land: Deutschland
Webseite: www.docpharm.de
Telefonnummer: +49 721 790709-0
Email: info@docpharm.de
Weitere Artikel aus dieser Kategorie:
Diese Artikel wurden oft angesehen: